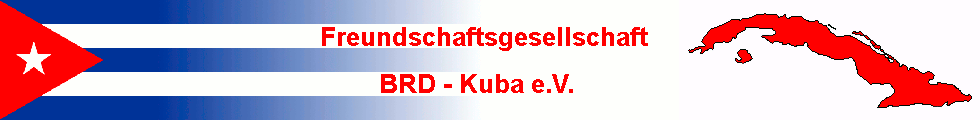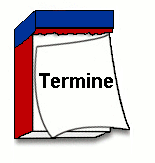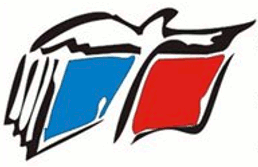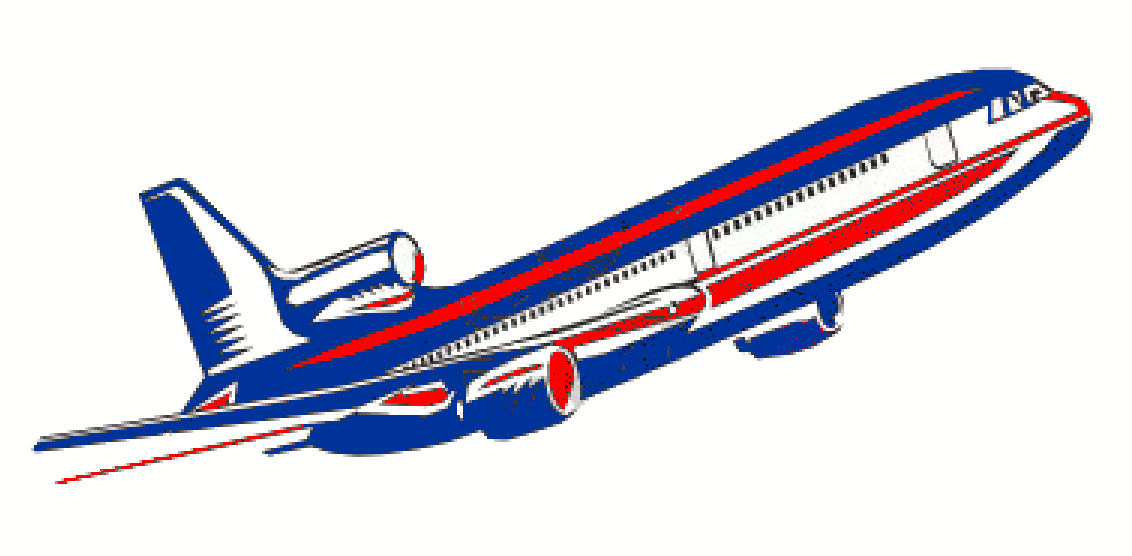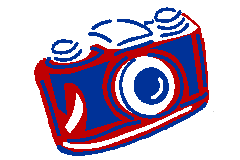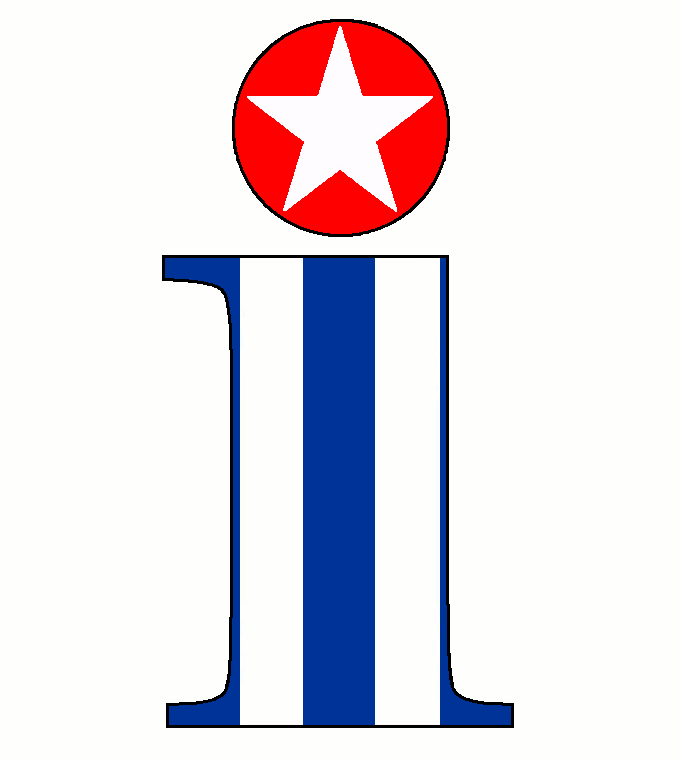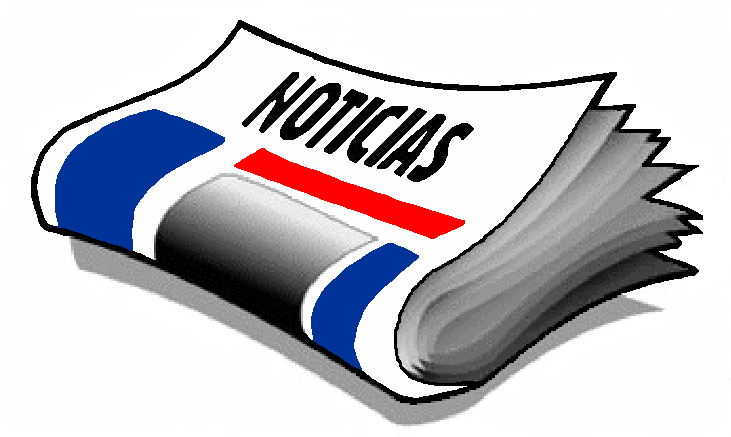
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
»Nichts kann das Lesen eines Buches ersetzen«
Gespräch mit Nancy Morejón. Über die Überlebenschancen gedruckter Literatur, die deutsche Philosophie und den besonderen Charakter der kubanischen Kultur.

Nancy Morejón wurde am 7. August 1944 in Havanna geboren und ist bekannt als Dichterin und Übersetzerin. Ihre Werke erschienen in zahlreiche Sprachen und wurden vielfach ausgezeichnet.
Sie sind eine der leider recht wenigen zeitgenössischen kubanischen Autorinnen, deren Werk auch – zumindest teilweise – ins Deutsche übersetzt worden ist. Welche Kontakte haben Sie zu Ihren deutschen Lesern?
Ich habe ursprünglich von 1962 bis 1966 in Havanna französische Literatur studiert und mich in der Folge intensiv mit Europa beschäftigt, auch mit den Ereignissen von 1968 in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern. Es kamen damals sehr interessante Persönlichkeiten nach Kuba. Mein direkter Kontakt mit der Bundesrepublik begann 1982, als ich meine Übersetzerin kennenlernte, Ineke Phaf-Rheinberger. Sie hat 2010 meine Gedichte auf deutsch herausgegeben, »Wilde Kohlen«, eine sehr schöne Anthologie, die auf dem Titel zudem eine Zeichnung von mir trägt, die ich bei einem Workshop in der Kathedrale von Havanna anfertigen konnte. Ich betrachte mich nicht als professionelle Malerin, absolut nicht, aber ich illustriere gern, was ich schreibe.
Deutschland ist für viele Dinge ein Leuchtturm. Historisch war es ein Land, daß nicht zu sehr in den Kolonialismus in Amerika verwickelt war, anders als etwa die Niederlande auf den Antillen. Deutschland war eine Großmacht des Denkens, angefangen bei Hegel und Kant. Meine erste Jugend war überhaupt geprägt von der deutschen Philosophie, etwa von Feuerbach und natürlich von Marx und Engels. So lernten wir auch die Welt von Ernst Thälmann, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin kennen, das war unser tägliches Brot.
Auf literarischem Gebiet ist Deutschland eine wirkliche Großmacht, und ich konnte zu einigen Literaturfestivals und Kulturveranstaltungen kommen. 2011 haben wir etwa mein von Phaf-Rheinberger in deutscher Übersetzung herausgegebenes Werk bei einer Buchmesse vorstellen können, und in diesem Jahr war ich beim Internationalen Literaturfestival in Berlin zu Gast. Das sind für mich große, wichtige Erfahrungen. Ich spreche nur wenig Deutsch. Ich hatte zwar 1961 angefangen, es zu lernen, mußte das aber aufgeben, weil ich mich an der Alphabetisierungskampagne beteiligt habe. Beides zugleich und dann auch noch Französisch zu lernen, das war nicht möglich.
Können Sie mir etwas über Ihre Erfahrungen bei der Alphabetisierungskampagne erzählen, durch die der Analphabetismus in Kuba beseitigt wurde?
1961 war ich 16 Jahre alt, und ich habe vielen Menschen Lesen und Schreiben beigebracht. Ich erinnere mich an Rosalía, eine Santera (Santeria-Priesterin) und Mulattin, sowie an eine Spanierin mit Namen Carmen. Für mich war es besonders beeindruckend, daß ich einer Spanierin Lesen und Schreiben beibringen konnte. Spanisch ist schließlich unsere Muttersprache, und es war für mich schwer vorstellbar, daß eine Spanierin – sie sprach spanischen Akzent und alles – nicht lesen und schreiben konnte. Sie war in den 30er Jahren, kurz vor Beginn des Spanischen Bürgerkrieges, nach Amerika gekommen, um sich neue Horizonte zu eröffnen. Sie hatte Argentinien, Mexiko, Puerto Rico und schließlich Kuba bereist. Aber ich habe ihr die Unterschiede zwischen Vokalen und Konsonanten erklärt – eine sehr interessante Erfahrung. Sie sprach sehr gebildet, aber vom Schreiben hatte sie keine Ahnung. Diese Frau hat einen Chinesen geheiratet, und die beiden hatten einen Sohn, Parfai, ein wunderhübscher, lieber Junge, der später studierte, den ich aber aus dem Blick verloren habe.
Die Alphabetisierungskampagne war etwas Wunderbares, denn durch sie hatte meine Generation die Möglichkeit, den Menschen die Horizonte zu erweitern. Ich glaube, das hat in mir den Sinn für Gegenseitigkeit geweckt. Ich hatte aufgrund der Anstrengungen meiner Eltern Zugang zu Bildung, und die Revolution hat mir auch den Zugang zur Universität eröffnet. Mein Vater war Seemann und Stauer im Hafen, und es hatte ihm immer sehr leid getan, daß er und meine Mutter nicht das Geld hatten, um mir den Besuch der Universität zu ermöglichen. Der kostete damals 100 Pesos pro Monat, und das war ein Vermögen, denn die Gehälter lagen bei 20 oder 25 Pesos. Doch dann kam die Revolution, und der Universitätsbesuch wurde kostenfrei.
So trat ich 1962, direkt nach Abschluß der Alphabetisierungskampagne, in die Fakultät für Kunst und Sprachwissenschaften der Universität Havanna ein und spezialisierte mich auf französische Literatur. Aber die Franzosen und Deutschen sind in gewisser Weise die zwei Seiten derselben Medaille, sehr nachdenklich. Damals wurde etwa Herbert Marcuses »Eros and Civilization« übersetzt, und ich denke auch an Veränderungen im deutschen Denken, die über den traditionellen Marxismus hinausgingen. Wir haben Theodor Adorno und Walter Benjamin entdeckt, aber wir haben uns nie vom Marxismus entfernt, wie ihn Marx und Engels in ihren eigenen Texten beschrieben haben. Viele Schriften waren damals noch gar nicht übersetzt und veröffentlicht. So waren uns die Manuskripte von 1844 nicht bekannt. Auch mein Vater, der Mitglied der ersten sozialistischen Partei Kubas gewesen war und sein Leben für die Arbeiterbewegung eingesetzt hat, hatte nie etwas von diesen Manuskripten und der Kritik von Marx und Engels an der deutschen Philosophie gehört. Zugleich haben wir uns auf die Originalität der Kubanischen Revolution gestützt, die von einem Guerillastützpunkt in der Sierra Maestra ausgelöst wurde, aber das Ergebnis eines Prozesses war. Dieser hatte bereits im 19. Jahrhundert begonnen, mit dem Kampfruf von Carlos Manuel de Céspedes am 10. Oktober 1868 und 1895 mit der Person José Martís als Zentrum des zweiten Unabhängigkeitskrieges, der als »der notwendige Krieg« in die Geschichte eingegangen ist. Schließlich die »Revolution von 1930«, durch die der Diktator Gerardo Machado gestürzt wurde. Ein hochinteressantes Ereignis, auch wenn der Aufstand letztlich scheiterte. Schließlich die Revolution aus der Sierra Maestra mit Fidel und Raúl, die am 1. Januar 1959 siegte.
Wir hatten nie Probleme mit Europa, denn von außerhalb gesehen müssen wir Europa nicht als Feind betrachten. Unser Europa ist das von Marx und Engels und das der vielen anderen großen Denker, die es gegeben hat und die dazu beigetragen haben, aus uns das zu machen, was wir sind.
Viele lateinamerikanische Marxisten hatten in der Vergangenheit aber durchaus ihre Probleme mit Marx, so wegen dessen vernichtender Kritik an Simón Bolívar oder wegen der Unterstützung der Annexion Mexikos durch die USA …
Das Problem ist, daß niemand in einer Epoche lebt, in der er nicht geboren wurde. Deshalb ist es sehr schwierig, zu verstehen, was die Leute in ihrer Zeit bewegt hat. Das gilt auch für viele Schriften von Marx und Engels, zum Beispiel für ihre Positionen zu Indien. 1990 habe ich in Buenos Aires mit dem großen, sehr sympathischen und leider 1997 verstorbenen brasilianischen Anthropologen Darcy Ribeiro an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Bei der Diskussion sprach alle Welt von Marx und Engels, aber Darcy wies darauf hin, daß das einzige Problem sei, daß weder Marx noch Engels jemals einen Motor gesehen hätten. Die Leute lachten, aber es ist doch so: Marx kannte zum Beispiel keine Autos und konnte deshalb kaum solche Phänomene voraussehen, wie wir sie heute erleben. Marx und Engels waren schließlich keine Götter, sondern Menschen, die ihr Wissen und ihre intellektuelle Arbeit für eine edle Sache eingesetzt haben.
Es gibt aber immer Extremisten, die Ideologie und Politik verwechseln. Ausgehend von den Erfahrungen in Osteuropa und in der Sowjetunion wurde nach Stalin das ganze Phänomen Trotzkis und des Trotzkismus fehlinterpretiert, und in der Folge wurden falsche Schlußfolgerungen gezogen. Wir kennen ja die Erfahrungen des Personenkults, aber diesen dem Marxismus vorzuwerfen, ist ungerecht. Wenn wir Marx lesen, erkennen wir in den Schriften eine klare und transparente Ideologie.
Das gilt natürlich genauso für Dary Ribeiro, der wunderbare anthropologische Bücher über Brasilien und Lateinamerika geschrieben hat. Aber das heutige Brasilien, das der Präsidentin Dilma Rousseff, und auch schon das von Lula da Silva, konnte er nicht kennen.
Das Großartige an Marx und Engels ist meiner Meinung nach, daß sie ihre Gedanken für die Moderne entwickelten, zugleich aber in der deutschen Tradition verwurzelt blieben. Das zeigen die Texte über Hegel oder über Feuerbach. Sie sind Teil ihrer Tradition, und das bestreiten sie auch gar nicht. Aber Marx überwindet sie, weil er einer anderen Generation angehört. Wir tun ja auch nichts anderes, wir stützen uns ebenfalls auf die, die vor uns kamen.
Die Welt von Bolívar war für Marx und Engels eine unbekannte Welt, die sie nicht kannten. Und wenn man zum Beispiel an die Mexikanische Revolution ab 1910 denkt, dann war sie etwas völlig anderes als die heutige Revolution von Hugo Chávez in Venezuela. Der Wert der eingeborenen, indigenen Kulturen war auch für Mexiko bedeutend, aber was wir heute angefangen in Venezuela, Bolivien und Ecuador erleben, zeigt, daß diese Kulturen lebendig sind. Sie haben die Verhältnisse in der Welt der Linken, der Alternativen verändert.
Volker Hermsdorf, ein häufiger jW-Autor, berichtete vor einigen Wochen von einem Krankenhausaufenthalt in Kuba. Neben ihm lag ein alter Machetero, ein Bauer, der ihn plötzlich fragte, ob er »Hundert Jahre Einsamkeit« von Gabriel García Márquez gelesen habe. Unser Autor war von diesem scheinbaren Widerspruch beeindruckt …
… weil es kein Widerspruch ist, sondern eine andere Art, die Welt wahrzunehmen. Dieser Mann hat das Lesen und Schreiben vielleicht gerade in jener Zeit gelernt, von der wir vorhin gesprochen haben. Ich habe oft erzählt, daß ein Buch in Kuba billiger war als eine Kugel Eis. Heute ist das nicht mehr so, weil Papier sehr teuer ist, aber der Zugang zu Kultur und Literatur hat bei uns noch immer einen hohen Stellenwert. Deshalb kann so ein Mensch in Kontakt mit einer Avantgarde-Literatur wie der von García Márquez kommen und deren Bedeutung verstehen. Wir sprechen oft über Macondo, den fiktiven Ort, in dem »Hundert Jahre Einsamkeit« spielt, wie über eine reale Gemeinde. Tatsächlich aber faßt diese Stadt die gesamte Geschichte unseres Kontinents zusammen. Auch deshalb ist die Sensibilität dieses Mannes so beeindruckend, der vielleicht keinen hohen Bildungsstand hat, aber ein Leser der Bücher von Gabriel García Márquez ist. Viele andere Menschen konsumieren nur den Müll der Massenmedien, schlechte kommerzielle Filme, in denen es nur ums Töten geht. Dieser Mann aber ist in der Lage, den Wert eines literarischen Werks wie »Hundert Jahre Einsamkeit« zu schätzen.
Das konnten wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf der Internationalen Buchmesse in Havanna erleben, an der sich junge Welt beteiligt hat. Dieses Fest der Literatur …
… ist ein Krieg.
Ein Krieg?
Ein Krieg, denn das Imperium des Kommerzes versucht, das Buch verschwinden zu lassen. Es denkt, daß alles Digitale weit über dem gedruckten Buch steht. Tatsächlich aber kann nichts das Lesen eines Buches ersetzen, das Anfassen und Öffnen eines gedruckten Werkes. Von außen glänzt manches wie ein Diamant, innen aber stinkt es nach Abfall, wird Gewalt propagiert und verschwinden Werte wie der Respekt vor dem Nächsten. Das ist doch schrecklich, das wollen wir unterwandern und bekämpfen. Eine Welt, die sich nur auf die Entdeckungen und Entwicklungen der Wissenschaft stützt, aber die Menschlichkeit, die wirkliche Natur des Menschen, aus den Augen verliert, ist doch undenkbar.
Als das Fernsehen erfunden wurde, dachte man, das Radio würde verschwinden. Aber bis heute spielt das Radio seine Rolle, und auch in Zeiten des Internet hat es seine Bedeutung behalten. Das gilt auch für das Buch, für das ein Weg gefunden werden muß. Natürlich kann niemand die Bedeutung der elektronischen Medien bestreiten, und niemand will diese bekämpfen – aber wir müssen sie menschlich machen. Wir müssen uns bewußt machen, daß ein Medium nicht ein anderes umbringt. Das Radio hat nicht das Theater getötet, das Fernsehen hat nicht das Radio getötet. So wie es Internetradios gibt, haben auch die digitalen Bücher ihren Wert und ihre Berechtigung. Aber es gibt keinen Grund, warum wir die gedruckten Bücher beiseite legen sollten. Wir dürfen nicht zulassen, daß sie vernichtet werden, weil jemand entscheidet, daß die Menschheit sie nicht mehr braucht. Nein, alle Medien sollen leben.
Aber die Herstellung eines Buches ist sehr teuer, verglichen mit dem Betrieb einer Internetseite …
Richtig, deshalb müssen wir einen Mittelweg finden, eine Sprache, in der nicht das eine das andere tötet. Warum sollte es kein Plakat oder Flugblatt mit einem Gedicht von José Martí mehr geben? Nicht alles kann man auf einem Bildschirm abbilden. Denken wir mal an das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen – das kann auch auf einem Bildschirm schön sein, aber es ist doch etwas anderes, wenn Kinder ihr Märchenbuch aufschlagen und lesen. Die Gefahr ist, daß alles dem Markt unterworfen wird: Wenn es sich auf dem Markt behauptet, existiert es, wenn nicht, verschwindet es. Das ist doch traurig.
Kommen wir zurück auf Ihre Bücher. In Besprechungen wird oft hervorgehoben, daß Ihre Gedichte afrokubanisch und feministisch geprägt sind. Teilen Sie diese Bewertung?
Etiketten machen mir Angst. Tatsache ist, daß Nancy Morejón eine schwarze Kubanerin und eine Frau ist. Natürlich sind das, nach meinem Verständnis vom Schreiben, besondere Charakteristika, aber sie stehen nicht unabhängig von meinem gesellschaftlichen Wirken, von dem, was ich tue und was ich tun sollte. Meine Wahrnehmung Kubas geht aus von Juan Gualberto Gómez, dem großen Freund José Martís im 19. Jahrhundert. Er war ein Schwarzer, fast noch ein Sklave, dem es gelang, sich zu befreien und zum Studium nach Paris zu gehen. In dem Krieg, der 1895 begann, war er die rechte Hand von José Martí. Aus den Ideen von Juan Gualberto Gómez ist der große kubanische Schriftsteller Nicolás Guillén hervorgegangen.
Welches sind diese grundlegenden Ideen? Erstens der Satz von José Martí: Die Menschheit ist das Heimatland. Zugleich aber das Bewußtsein, daß Kuba eine eigene Welt ist, die sich aus spanischen und afrikanischen Elementen neu zusammensetzt. Das bedeutet: Wenn ich nicht den Mund aufmache, könntest du vielleicht glauben, daß ich aus Barbados komme oder aus einem Ort in Südafrika oder aus New York. Aber wenn ich rede, spreche ich Spanisch, meine Muttersprache. Die Cubanidad geht sogar noch darüber hinaus. Ich war einmal in New York und hielt mitten auf der Straße ein Taxi an, und es stoppte ein Fahrer, der ebenfalls Kubaner war. Er fragte mich gleich: »Wann bist du angekommen?« Er wußte sofort, daß ich Kubanerin bin, obwohl ich nur den Arm ausgestreckt hatte, um ihn anzuhalten, und er duzte mich auch augenblicklich. Das ist ein starker Ausdruck dieser Cubanidad, der ich mir sehr bewußt bin und die ich verteidige. Aber dieses Mulattin und Kubanerin sein, diese Vermischung, ist keine rassische Frage. Ich kann mich mit einem Kubaner treffen, der aussieht wie du, mit blonden Haaren und blauen Augen – wenn die Trommel ertönt, fangen wir an zu tanzen, und ich weiß sofort, daß er kein Deutscher sein kann. Das ist keine Sache, die nur die Schwarzen und Mulatten in Kuba haben, das ist ein Phänomen der Cubanidad, und ein Ausdruck unserer Zeit. Denn im 19. Jahrhundert war das noch anders. Damals war der Son verboten, aber diese Werte haben sich im Zuge unseres revolutionären Prozesses verändert.
Zugleich sind wir uns bewußt, daß Spanien uns Autoren viele Werte vermittelt hat, denn wir sprechen und schreiben in Spanisch. Ich kann das nicht anders. Ein Maler kann sich eine andere Variante aussuchen, aber ich arbeite mit den Worten und schreibe auf Spanisch. So vermittelt Spanien viele grundlegende Werte, aber auch Spanien selbst ist ein Phänomen der Durchmischung. Über Jahrhunderte haben die Mauren Spanien beherrscht, und aus dieser Zeit stammen viele Worte, die wir für urspanisch halten, die aber aus dem Arabischen kommen, vor allem im Süden Spaniens, denn Asturien ist etwas anderes als Andalusien. Man kann also nicht verallgemeinern, denn auf der anderen Seite kommt in Kuba das afrikanische Element dazu, das die schwarzen Sklaven mitbrachten. Und wir haben auch chinesischen Einfluß. Die Vorfahren meiner Mutter kamen zum Beispiel aus Macao, denn als England Spanien wegen der Sklaverei verfolgte, mußte der Sklavenhandel mit Schwarzen verborgen und in vielen Fällen aufgegeben werden. Als Ersatz holten sie Chinesen ins Land, die Kulis genannt wurden. Diese Kulis kamen zwar nicht als Sklaven, waren aber fast selbst Sklaven, praktisch waren sie in der gleichen Situation und lebten in den gleichen Barackensiedlungen wie die schwarzen Sklaven. So entstand die Vermischung von Schwarzen und Mulatten mit Chinesen. Und es gab auch sephardische Juden, die aus Spanien nach Kuba kamen. In Havanna existiert zum Beispiel ein sephardischer Friedhof, und an der Calle 26 gibt es einen eigenen chinesischen Friedhof. Wir sind also eine große Mischung der Kulturen, wie die Bewohner deranderen Länder der Karibik auch.
In deutscher Sprache liegen von Nancy Morejón vor: Carbones Silvestres – Wilde Kohlen, Berlin 2012; Ruhmreiche Landschaft, Esslingen 2001
|
Veröffentlichung |
Interview: André Scheer
junge Welt, 02.11.2013