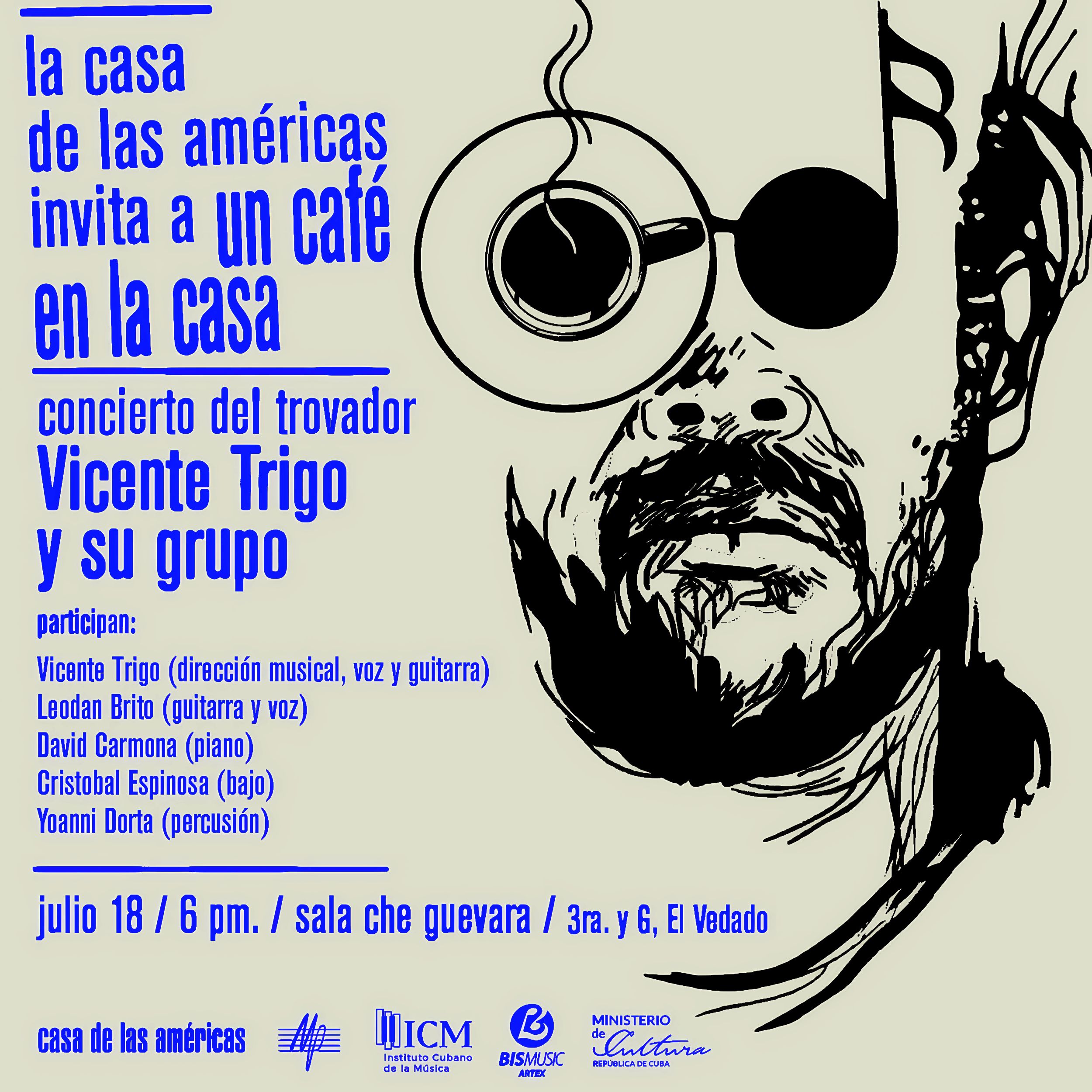Die Leidensfähigkeit kubanischer Künstler
Vicente Trigo in der Casa de las Americas
Von Uli Fausten
Wenn irgendetwas in Kuba subventioniert
wird bis zum Gehtnichtmehr,
dann ist es die Kultur. Bei vielen
– nicht bei allen – Konzerthallen
gilt: „freier Eintritt“, so auch in der
legendären Casa de las Américas.
Allein, falls man im Hochsommer,
zum Beispiel Freitag, den 18. Juli,
dort einem Auftritt beiwohnen
will, sollte man sich das nochmal
gut überlegen. In Zeiten der Energieknappheit
wird die recht große
„Sala Che Guevara“ durch zwei (in
Ziffern: 2) Wandventilatoren belüftet.
Ich bin ohne nennenswerte
Schäden über jenen Abend gekommen,
weil ich zirka 1 ½ Meter unter
einem von ihnen saß. Der Protagonist
dieser Veranstaltung, Vicente
Alejandro Trigo, Bandleader
der Gruppe „DCoraSon“, hatte das
Glück leider nicht. In den sich häufenden
Pausen zwischen den Stücken
zerfloss er schier vor unseren
Augen. Wir litten mit ihm, umso
mehr, als das Konzert eigentlich
klasse war ...
Der familiäre Einfluss auf das,
was er heute macht, kam von seiner
Mutter wie auch von seiner Großmutter.
Die beiden waren übereingekommen,
den Minderjährigen
im Alter von 14 erstmalig mit Liedern
von Silvio Rodríguez und Pablo
Milanés bekannt zu machen und
somit seine Erziehung zum Lieben
guter Musik zu betreiben – ein Begriff,
den näher zu definieren ich
mich schlichtweg weigere. Im Alter
von 17 Jahren begann er, seine eigenen
Stücke zu schreiben. Ein Jahr
später zeigte er sie zum ersten Mal
vor – dem Tres-Spieler, Komponisten
und Arrangeur Ibrán Rivero
Pío, der von dem Neuling auf der
Szene so angetan war, dass er eine
Weile mit ihm zusammenarbeitete.
Die beiden bildeten ein Duo, das
sich auf Gitarre und Tres begleitete.
Die Musik – sehr kubanisch,
die Songtexte reich an Metaphern.
Nach einer Zeit der Trennung fanden
sie sich dann aber wieder –
und zwar in der in Kuba nun wirklich
bekannten Formation „Aceituna
sin Hueso“ (auf Deutsch: Olive
ohne Kern). Die unverwechselbare
Band der kreativen Frontfrau Miriela
Moreno war, wie Vicente kürzlich
als Gast in der von Rey Montalvo
und Martha Campos moderierten
Sendung „Entre Manos“ sagte,
seine erste Erfahrung mit jener
„anderen Dynamik, die das Singen
und Spielen vor Publikum“ darstellt.
Das Projekt „DcoraSon“ setzt
sich dann auch überwiegend aus Ex-
Mitgliedern von „Aceituna sin Hueso“
zusammen. Alle fünf teilen neben
der Liebe zur Nueva Trova eine
Affinität zur traditionellen Musik
und zum Son. Ich habe nie so ganz
verstanden, was das Genre „Son“
eigentlich ausmacht. Wenn „Pupy
y Los que son Son“ den Son spielen
(oder besser gesagt spielten, denn
Pupy weilt ja nun leider nicht mehr
unter uns), wo sind dann die Gemeinsamkeiten
mit Vicente Trigo?
Ein weiterer – ebenso unbefriedigender
– Versuch der Standortbestimmung
besteht in der Aussage,
„DCoraSon“ bewege sich zwischen
zwei solchen Extremen, wie
es Silvio Rodríguez und Miguel Matamóros
darstellen. Immerhin wird
eingestanden, wie weit diese beiden
auseinander sind. Silvio und das
Trio Matamóros – das ist zur Verortung
eines Cantautors ungefähr
ebenso hilfreich, als würde jemand
sagen, dieser oder jener Interpret
befinde sich musikalisch irgendwo
zwischen Howard Carpendale und
ACDC.
Vielleicht ist die Suche nach der
passenden Schublade eine besonders
ausgeprägte kubanische Manie.
Als gehöre es zum Glücklichsein,
zu wissen, wovon man spricht.
Dem habe ich mich nie anschließen
können. Auch nicht als Kulturjournalist.
Meine schönsten Konzerte
waren häufig solche, die Irritation
bei mir auslösten, weil ich sie
spontan keiner Kategorie zuordnen
konnte oder weil sie sich Kategorien
gegenüber sperrten, die zu erleben
ich erwartet hatte. Das Konzert in
der „Casa“ begann genau so. Komplex,
unerwartet, nicht zum Mitsingen.
Und ich lehnte mich in meinem
gut bewehten Stuhl zurück und
durfte einmal mehr denken: „Das
wird spannend“.
Manche meinen auch, Elemente
von Rumba und Changüi bei „DCoraSon“
zu erkennen. Und tatsächlich
gab es ein Changüi-Stück im
Konzert – wie generell lateinamerikanische
Genres, was sicher zutrifft.
Auch Country sollen sie spielen
(Blödsinn!). Pop? Anklänge von
Pop sind bei „Buena Fe“ jedenfalls
viel stärker ausgeprägt. Balladeskes?
Das findet sich schon in ihrem
Repertoire. Eine Referenz, die auffallend
fehlte, war die, dass nicht
Weniges auch an anspruchsvollen
angelsächsischen Folk erinnerte.
Das liegt auch daran, wie Instrumente
zum Einsatz gebracht werden.
Neben Vicente Trigo selber
(Gitarre und Stimme) gibt es mit
Leodan Brito einen zweiten singenden
Gitarristen und der spielt E-Gitarre.
Darunter darf man sich jetzt
keine harten Riffs und schwindelerregenden
Läufe vorstellen. Leodan
spielt seine elektrische Gitarre
fast so, als wäre es eine akustische
– ohne jede Effekthascherei.
Der Vollständigkeit halber seien die
drei übrigen erwähnt: David Carmona
(Keyboard), Cristobal Espinoza
(Bass) und Yoanni Dorta (Percussion).
Diese famose Gruppe, die wahrlich
eine größere Zuhörerschaft
verdient gehabt hätte, spielte zunächst
an eher kleinen Orten, wie
dem Centro Cultural Fresa y Chocolate
gegenüber dem Kino Chaplin,
in der Casona de Línea, der Location
mit den meisten Mücken in
ganz Havanna, und in „Los jardines
del Teatro Mella“. Eine Adresse, die,
seit das Theater selbst geschlossen
wurde (endgültig oder wegen Renovierungsarbeiten,
für die das Geld
fehlt, wer weiß es?), etwas auf den
Hund gekommen ist. Inzwischen
nimmt ihre Fernsehpräsenz zu,
z. B. in 23 y M, Lucas, Hola Habana.
Vicente selbst äußerte sich in einem
Interview zur Entwicklung
von „DCoraSon“ mit den folgenden
Worten:“Ich träumte immer
davon, eine Band zu haben, mit der
ich das würde machen können, was
ich heute mache. Aber ich hätte nie
gedacht, dass das so schnell gehen
würde. Das erste, worum es ging,
war, ein Repertoire zu schaffen,
dessen Themen – Texte und Musik
– von uns selber sind. Wir machen
auch unsere eigenen Aufnahmen
dank eines semiprofessionellen
Audio-Computers und unserer
Kondensator-Mikrophone.“
Der Auftritt am 18. Juli in der
Casa de las Américas lief unter dem
Titel „Un café en la Casa“ in Anspielung
auf ihr Album „El café de los
felices“ – 2024 Sieger des Cubadisco-
Awards in der Kategorie „Zeitgenössisches
Lied“.
Um nochmal auf das leidige Thema
vom Anfang zurückzukommen:
Es wäre vielleicht angezeigt gewesen,
auf die wesentlich kleinere Sala
Manuel Galech im Erdgeschoss auszuweichen,
die man mit geringerem
Aufwand hätte klimatisieren können.
Und die hundert Leute Zuhörer,
die wir waren, hätten da wohl
reingepasst. Aber womöglich wollte
man nicht nur ein bisschen sparen,
sondern ganz viel. Natürlich macht
die Sala Che Guevara letztlich auch
mehr her, aber das an dem bewussten
Abend war, genau betrachtet,
unzumutbar. Zumindest für die
Künstler.
Das Konzert war umständehalber
eines der kürzesten, die ich je
erlebt habe. Gerade mal eine Stunde.
Und obwohl es eine durchaus intensive
Stunde war, mit positivem
Dialog zwischen Band und Publikum,
gab es keine Zugabe. Bemerkenswert
(und über die Maßen ungewöhnlich)
war, dass es auch niemanden
gab, der eine forderte. Hier
verstand man sich ohne Worte.