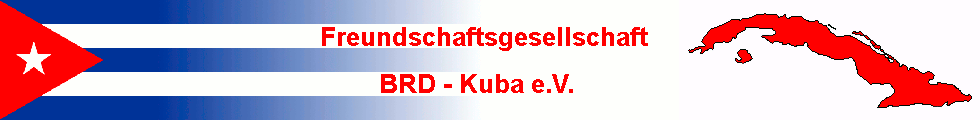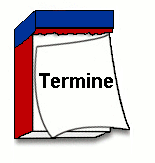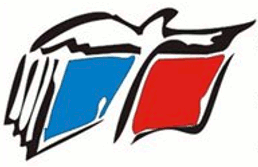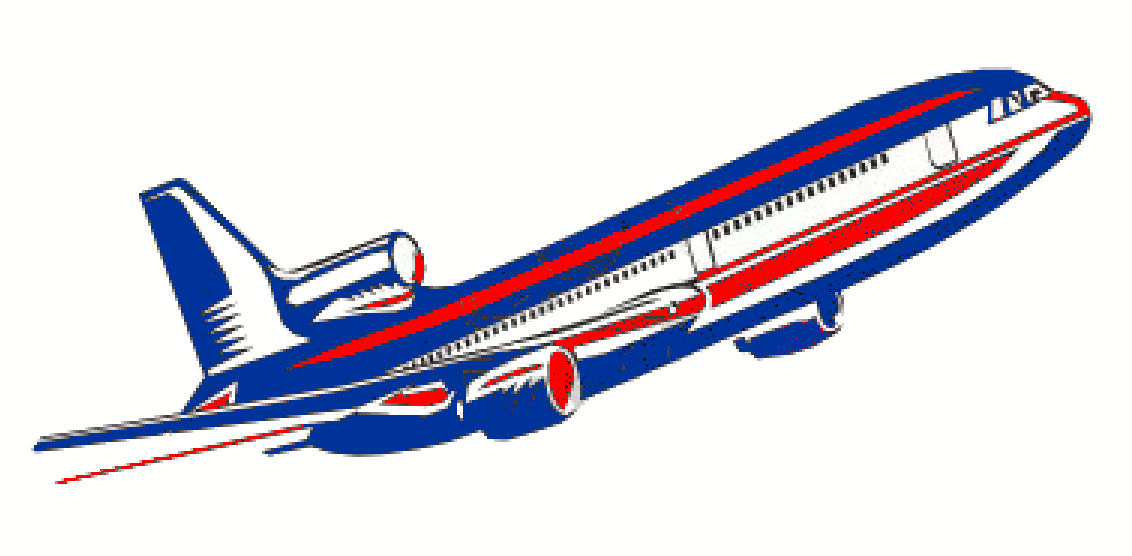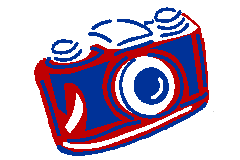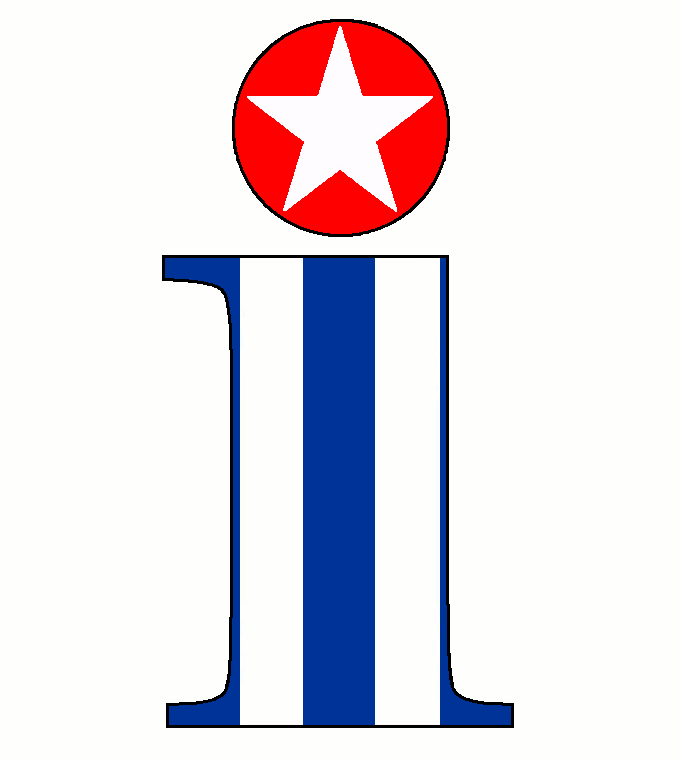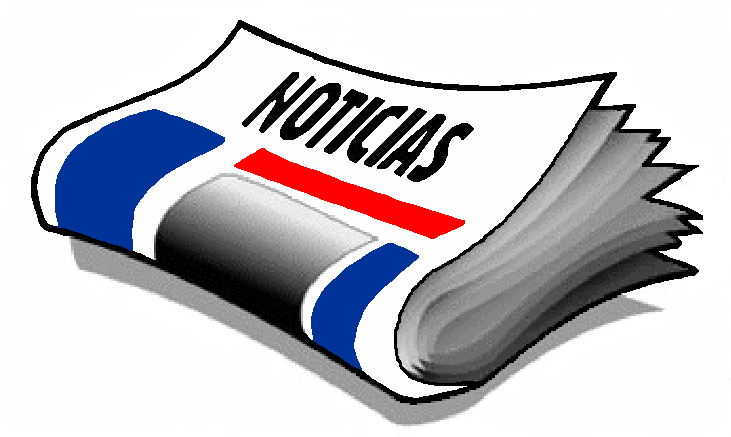
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
Grundlagen der Guerilla
Che Guevaras Buch »Der Partisanenkrieg«. Eine Relektüre zum 95. Geburtstag am 14. Juni.
Am 2. Dezember 1956 landeten 82 Kämpfer unter der Führung Fidel Castros an der kubanischen Küste. Anfang Januar 1959 befreite die siegreiche Guerilla Havanna. Nach kaum mehr als zwei Jahren Partisanenkrieg war ein kleines Häuflein von Aufständischen zu einer erfolgreichen Armee angewachsen und hatte die Grundlage der Kubanischen Revolution erkämpft.
Einer der wichtigsten Kommandanten dieser Truppe war Ernesto »Che« Guevara. In seinem Buch »Der Partisanenkrieg« fasste er kurz nach dem Sieg die Erfahrungen des Konflikts zusammen. Dabei ging es dem 31jährigen nicht darum, verfrühte Memoiren zu schreiben. Vielmehr schrieb er eine Anleitung, wie eine Guerilla zum Erfolg zu führen sei.
Schon die Fragestellung war alles andere als selbstverständlich. Die Kriegstheorie bis ins frühe 20. Jahrhundert kannte natürlich den Partisanenkrieg, doch diente die Guerilla nur zur Unterstützung regulärer Streitkräfte, denen die eigentliche Entscheidung zufiel. Das entsprach dem tatsächlichen Verlauf der Kriege, zumindest in Europa. Noch im russischen Revolutionskrieg formierte Trotzki die Rote Armee als reguläre Truppe.
Richtig daran war und bleibt, dass eine Guerilla, um nicht nur einzelne Gefechte, sondern den Krieg zu gewinnen, im letzten Stadium als reguläre Armee auftreten muss. Dieses Stadium kann allenfalls fehlen, wenn der Gegner keine eigene Substanz hat: Die Regierung in Kabul war 2021 nach dem US-Abzug derart schwach, dass die Taliban keine größeren Schlachten auskämpfen mussten.
Das bekannteste Gegenbeispiel ist China, und dort findet sich mit Mao Zedong ein Kriegstheoretiker, dem Che Guevara in mehrerer Hinsicht nahesteht. Einschlägig ist vor allem Maos »Strategie des chinesischen revolutionären Krieges« von 1936. Hier entwarf er seine Konzeption einer kommunistischen Revolution, die sich auf die Bauernschaft stützt. Im Kampf gegen die Guomindang musste es zunächst darum gehen, der strategischen Offensive der stärkeren bürgerlichen Kräfte eine eigene Offensive im taktischen Bereich entgegenzusetzen. Doch sollte dies nur ein erster Schritt sein, angesichts der feindlichen Überlegenheit die eigene Macht aufzubauen, und stand für Mao außer Frage, dass die Revolution durch Kämpfe regulärer Armeen siegen würde. So geschah es denn auch in der letzten Phase des chinesischen Bürgerkriegs bis 1949.
Wie Mao sah Che Guevara den Partisanenkrieg als zunächst Sache der ländlichen Bevölkerung an. In der Stadt können sich größere Kampfgruppen nicht über längere Zeit verbergen, erst recht nicht versorgen. Die ersten, wenigen Partisanen bilden eine Avantgarde, und sie wenden sich an die Bauernschaft. Die Landbevölkerung kennt ihr Terrain, damit ist sie einrückenden Regierungstruppen überlegen.
Es geht also um »bewaffnete Abteilungen, die erfolgreich gegen die Machthaber in kolonialen und halbkolonialen Ländern kämpfen«, und einen Kriegstyp, »der sich auf der Basis des Kampfes in landwirtschaftlichen Gebieten herausbildet«. Ökonomische Grundlage sei das »Streben nach Boden«, also die Notwendigkeit einer Landreform. Politische Voraussetzung ist die Diktatur; dort »wo wenigstens dem Anschein nach die verfassungsmäßige Gesetzlichkeit gewahrt wird, entsteht keine Partisanenbewegung, weil noch Möglichkeiten des Kampfes mit friedlichen Mitteln vorhanden sind«. Auch müssten die Partisanen sich der Unterstützung durch die Bevölkerung sicher sein.
Diese Bedingungen zeigen an, dass eine Übertragung des Konzepts in Länder des globalen Nordens nicht möglich ist. Was immer sich die »Stadtguerilla« bis hin zur RAF zurechtlegte – auf Che Guevara kann sie sich nicht berufen. Derartige Versuche sind denn auch politisch wie militärisch allesamt gescheitert.
Che Guevara denkt an den Erfolg. Revolutionärer Pragmatismus durchzieht sein Buch, und in den besten Passagen verhöhnt er Kriegerehre. Manche Leute würden die Partisanen verhöhnen, weil diese punktuell angreifen und dann wieder weglaufen würden. Aber Che Guevara will nichts von »romantischen, den Regeln eines Sportwettkampfs ähnlichen Vorstellungen« vom Krieg wissen. Es geht nur um das übergreifende Gesetz: »Krieg bedeutet stets Kampf, in dem jede der kämpfenden Seiten die andere zu vernichten trachtet.«
Das ist nicht wertfrei zu verstehen. Schließlich geht es Guevara um die Vernichtung der reaktionären Seite. Sein Buch – und in dieser Hinsicht geht er über Maos Beiträge hinaus – enthält eine Fülle praktischer Hinweise. Diese betreffen vielfach militärtechnische Fragen, nach Marschordnung, Angriffstaktik, Nachrichtenbeschaffung, Kampfausbildung oder Disziplinarordnung. Eine große Rolle spielt auch die Versorgung, von der Munition bis zum Schuhwerk. Zum Partisanenkrieg gehört darum auch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Auch diese hat ihren pragmatischen Aspekt: ohne die Bauern kein Essen. Aber stets geht es auch um politische Qualifizierung. Gute Propaganda, betont Guevara, stützt sich auf die Wirklichkeit statt auf Wunschbilder.
Stärke wie Schwäche des Buchs ist die Siegeszuversicht, die es durchzieht. »Der Partisanenkrieg« ruft zur Revolution auf, hilft bei ihrer Umsetzung und warnt zugleich davor, die kubanischen Erfahrungen unbesehen zu kopieren. Wer aber kaum vorkommt, ist der Gegner. Er scheint relativ leicht zu übertölpeln, und etwas wie Lernfähigkeit fehlt ihm bei Guevara völlig. Man muss sich daran erinnern, dass 1960 die algerische FLN auf dem Vormarsch war und große Teile Afrikas kurz vor der Dekolonisierung standen.
Doch lagen bereits 1960 Erfahrungen des Scheiterns vor. Die Huk auf den Philippinen waren der Counter insurgency ebenso erlegen wie die MNLA in Malaysia. Und auch die Erfolgsbilanz von Partisanen in den gut sechzig Jahren seither ist nicht überwältigend. In Lateinamerika gelang nur den Sandinisten in Nicaragua 1979 ein ähnlicher Sieg. Weltweit siegten Partisanen im letzten Vierteljahrhundert neben Afghanistan nur in Ruanda 1994, Zaire 1997 und im Südsudan 2011; die kosovarische UCK verdankt ihren Erfolg dem NATO-Bombenkrieg. Häufiger sind Fälle des Scheiterns (die LTTE auf Sri Lanka) oder langandauernde Pattsituationen (FARC, PKK, islamistische Gruppen in den pakistanischen »Stammesgebieten«, die indischen Naxaliten).
Aus der Aufzählung folgt erstens, dass nur manche Partisanen fortschrittlich sind. Zweitens: Ein schneller Erfolg wie auf Kuba ist ein Sonderfall. Che Guevara wurde 1967 bei dem Versuch ermordet, seine revolutionäre Strategie auf Bolivien zu übertragen – die Macht des Staates war schon damals nicht zu unterschätzen und ist heute eher noch gewachsen, aller Rede von »neuen Kriegen« zum Trotz. Aktuell bleibt das von Che Guevara erörterte Thema, wie Linke Staatsgewalt in die Hand bekommen können.
|
|
Kai Köhler
junge Welt, 17.06.2023